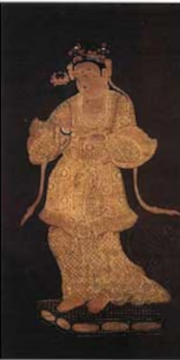Ihr Browser unterstützt das verwendete moderne Bildformat noch nicht. Betrachten Sie bitte diese Seite auf dem Desktop mit Google Chrome ab Version 82, Opera ab Version, Safari ab Version 16.1, oder noch besser Firefox ab Version 93.
Die Unannehmlichkeit bitte ich zu entschuldigen, aber die Steinzeitprodukte des Hauses Microsoft bedeuten zu viel zusätzlichen Aufwand.
Your browser does not support .avif images. Please view on a modern desktop browser. No apologies for not supporting Microsoft’s rubbish.
Enstehungsgeschichte
Kannon (觀音, vereinf.: 観音; Kanzeon, unreformiert auch: Kwannon. „die (flehenden) Laute der Welt betrachtend“1) ist die ostasiatische Variante des Bodhisattva Avolokiteśvara,2 der – wohl durch Verschmelzung mit einer chinesischen Sagengestalt – weibliche Züge angenommen hat. Als solches ist sie eine Göttin des Mitleids (karuṇā) und der Barmherzigkeit. In China wird sie als Kuan-shih-yin – was meist zu Kuan-yin (Pinyin: Guānyīn) verkürzt wird – bezeichnet. Es hielten sich aber bis in die Sung-Dynastie auch männliche Darstellungen, in Dūnhuáng entdeckte man eine mit Schnurrbart.
Eine Theorie zur Entstehung der weiblichen Form geht davon aus, daß die Gestalt der taoistischen „Königinmutter des Westens“ (西王母, Xīwángmǔ, W.-G.: Hsi Wang Mu) Vorbild war. Die bekanntesten ihrer Legenden ist die der Geschichte der Prinzessin Miào Shàn (妙善). Der volkstümliche Glaube sieht sie auf der Insel P’u t’uo-shan (普陀山, Pǔtuó Shān) beheimatet. Dort soll sie, die die dritte Tochter des Königs Miao chung gewesen war, wiedergeboren worden sein, nachdem sie Enra, den Herrn der Unterwelt durch Entführung in sein Reich vor ihrem Vater – der sie erschlagen wollte, weil sie gegen seinen Willen im „Kloster des weißen Spatzen“ blieb – gerettet hatte. Nach ihrer Rettung und Wiedergeburt heilte sie den erkrankten Vater, indem sie ein Stück ihres eigenen Fleisches auf eine Wunde legte.
Die Figur der Kuanyin ist konfessionsübergreifend, spielt aber besonders in den Schulen des Reinen Landes eine wichtige Rolle. Das „Paradies,“ das man mit ihrer Hilfe erreichen kann ist das Bǔtuóluò shān. (補陀落山, jp.: Fudaraku-sen) Es gibt zahlreiche reale und mythische Personen, die Inkarnationen dieses Bodhisattva sein sollen, so der „nördliche Himmelskönig“ (毘沙門天, jp. Bishamonten, Schutzpatron der Krieger; Pinyin: Píshāméntiān. Im japanischen Volksglauben ist er einer der sieben Glücksgötter. Hergeleitet von der indischen Gottheit Vaiśravaṇa, der auch Kubera oder Jambhala genannt wird.) oder der Dalai Lama.
Die Problematik Kuanyins beginnt schon mit seinem chinesischen Namen, dessen Identität mit dem vielfach im indischen Schrifttum und archäologischen Material bezeugten Avalokiteśvara-bo außer Zweifel steht. Von einem gestörten etymologischen Verhältnis der chinesischen Übersetzer zu der indischen Namensvorlage scheinen zunächst die unterschiedlichen früheren und späteren ideographischen Wiedergaben, in unserem Fall Übersetzungen, des indischen Namens zu zeugen. So haben sie von dem Namen in den ersten Jahrhunderten zu Unrecht (Wenn nicht die von Mironow [in, 1927, S. 241–52] aus einer zentralasiatischen Handschrift abgeleiteten Gegenargumente Verstärkung erfahren.) einen Bestandteil -svara „Laut, Ton“ abgetrennt und mit chin. yin „Laut, Ton“ übersetzt. Erst die spätere chinesische Wiedergabe des Namens durch Kuan-tzū-tsai enthält die erwarteten Bestandteile (-ava)lokay- (ch. kuan „herabsehen“) und īśvara (chin. tzū-tsai „Herr“). Die anderen chin. Wiedergaben erscheinen wie volksetymologische Verballhornungen, bei denen für das ch. Zeichen kuang „Glanz, Licht“ das gleichbedeutende indische āiloka und für das ch. Zeichen shih „Welt“ das gleichbedeutende ind. loka Pate gestanden haben müssen.
Nicht unbedingt eine sprachliche Entgleisung möchte auch Soper (Soper, Alexander C.; Literary Evidence for Early Buddhist Art in China; Artibus Asiae Suppl. 1959) in der am frühesten belegten Namensform mit Kuang- sehen, und im gleichen Sinn hält es L. Renou nach Mallmann (Mallmann, Marie Thérèse de; Introduction à l’étude d’Avalokiteçvara; Paris 1948, S. 79) für möglich, daß im Vorderglied des ind. Namens, durch ein Mißverständnis bzw. eine semasiologische Entwicklung verdeckt, die vedische Verbalwurzel ruc „leuchten“ enthalten ist. Ein sprachliches Ungeheuer ist […] „Kuan-shih-yin,“ weil es die beiden alternativen Elemente kuan (alokay-) und shih (loka) zu einem einzigen Namensgebilde zusammenführt. Diese Namensform ist aber durch den Gebrauch von seiten des großen Übersetzers Kumarajīva, u. a. in seinem Lotus-Sutra, geadelt und wird überdies von dem linguistisch unbeschwerten chin. Gläubigen, mit einiger Schwierigkeit wohl, verstanden als „der die Rufe der Welt wahrnimmt.“ Der am häufigsten benützten Kurzform des Namens Kuanyin haftet in westlichem Gebrauch die nur mit Vorbehalt berechtigte Vorstellung von einem weiblichen Wesen an.In China ist Kuanyin noch nicht in der frühesten, aber schon in der unmittelbar darauffolgenden Schicht des Mahayana-Schrifttums, d. h. im Lotussurta und in den A-mi-t’o-Texten (2/3. Jh.) bezeugt. K. ist da schon in Beziehung gebracht zum Reinen Land des Westens, in dem er zusammen mit Ta-shih-chih-B., (Samantabhadra) dem dort herrschenden A-mi-eo-t’o als Mitregent oderHelfer beigesellt ist.
Im siebten Faszikel des Lotus-Sutra wird ihr die Fähigkeit die Schreie aller Wesen der Welt zu hören zugeschrieben. Weiterhin gilt sie für Frauen als „kindgewährend,“ Beschützer vor Schiffbruch oder Sturm, sowie sämtlicher Gefahren oder Bedrohungen durch Schwert, Dämonen oder Feuer. Sie kann verschiedenste Verkörperungen annehmen um das Dharma zu lehren, was zu zahlreichen ikonographischen Darstellungen geführt hat. Vielfach hält sie in der Hand einen Weidenzweig, eine Lotusblüte und das Gefäß mit dem „himmlischen Tau.“ Im Herzsutra wird sie ch. als Kuan-tzu-tsai erwähnt. Das Sukhāvatī-Vyūha schildert sie als einen der Begleiter Amithabas. Im esoterischen „Mantra des großen Mitgefühls“ (Nīlakaṇṭha Dhāraṇī, ch.: 大悲咒 Dàbēi zhòu, W.-G. ta-pei chou = 千手陀羅尼 bzw. 大悲陀羅尼 skr. mahā-karuṇika-citta-dhāraṇī; jp.: 大悲心陀羅尼, Daihishin darani, kurz 大悲呪 Daihi shu. Im Kanon T. 1060, 1061 1111, 1113b Gedacht zur „Lustüberwindung“) stellt man sich hintereinander die Erscheinungsformen vor.
Im japanischen Buddhismus wird Shōtoku Taishi (572–621) als eine seiner/ihrer Verkörperungen betrachtet.3 Erwähnungen finden sich auch in den Reichsannalen, besonders dem Nihon shoki ab Jitō- und Temmu-Tennō. Spätestens seit dem 10. Jahrhundert beteten Kaiser vor im Palast aufgestellten Kannon-Bildnissen, besonders Kazan (968–10084) vereehrte sie. Die populäre Gründungs-Legende des Dōjōji (Wakayama-ken), in der gesagt wird, eine Taucherin habe zur Zeit Mommu’s die erste Repräsentation der 1000armigen Kannon in Japan aus dem Meer gehoben, findet sich erstmals im Hokke Genki (um 1040) und muß als Erfindung dieser späteren Zeit gelten. Im Ryōbu-Shintō ist ihr Kuni-no-sazuchi-no-Kami gleichgestellt. Im estorischen Buddhismus gehört sie zu den dreizehn angebeteten Gottheiten. Eine Vision dieses Bodhisattvas spielt auch bei Shinran, (親鸞) dem Begründer der Jōdō Shinshū eine wesentliche Rolle. Im Japan sind die Wallfahrten zu den „33 Kannon-Tempeln“ beliebt gewesen. Es gibt zwei moderne derartige Gruppen, eine in Westjapan (西国三十三所; Saigoku Sanjūsan-sho) und der Region um Bandō (坂東三十三所). Hergeleitet ist diese Zahl von den 33 verschiedenen Repäsentationen (十三觀音 bzw. 三十三尊觀音) chinesischer Tradition. Häufige Symbole sind Weidenzweig, Drache, Sutra(rolle), Heiligenschein, weiße Robe, Fischkorb, schlafender Lotus, mit gefalteten Händen, Medizin spendend, Wasser ausgießend usw. Im Handbuch Butsuzō zui (仏像図彙 Erstdruck 1690, erw. als Zōho shoshū …, Ōsaka 1792) sind sie beschrieben.
Obwohl von 33 Manifestationen gesprochen wird, waren in Japan vor allem sechs Typen, (六觀世音. Die vor allem in Gemälden dargestellte „Weißgewandige“ wurde erst später in der zentypischen Malerei populär) mit verschiedenen „Zuständigkeiten“ hinsichtlich den sechs Bereichen der Wiedergeburt üblich. Die aus dem chinesischen Text Zhìyǐ'S (T. 1911) hergeleitete Klassifizierung wurde in Japan von Shingon-Mönch Ono Ningai (951-1046) interpretiert und in den folgenden Jahrhunderten zur Vorlage für Gruppen (Im Nationalmuseum Nara gibt es eine nicht mehr ganz komplette Schriftrolle [30 ⨉ 1064,3 cm, datiert 1162] die auch Zeichnungen und Beschreibungen der sechs Typen enthält. Es ist wohl eine Kopie einer Rolle von 1078, die der Mönch Jōshin aus dem Kiyomizu-dera mit einem Kolophon versehen hatte. Statt der später üblichen 11köpfigen Kannon wird hier die weißgewandete Byakue-Kannon genannt) von „sechs Kannon.”
- 大悲觀世音
- „Großes Mitgefühl“ (skt. mahākaruṇā, ch. dàbēi, jap. shō „heilig”), errettet aus den Höllen.
- 大慈觀世音
- „Große Gnade“ (skt. mahā-maitrī, ch. dàcí) tausendarmig, errettet aus dem Reich der hungrigen Geister (preta).
- 師子無畏觀世音
- „Mut des Löwen,“ die pferdeköfige Batō-Kannon, errettet Tiere bzw. Wesen, die als solche reinkarniert wurden.
- 大光普照觀世音
- „Universelles Licht“ (ch. dàguāng pǔzhào), die Elfköpfige, errettet Asuras, also die als „Halbgötter“ wiedergeborenen.
- 天人丈夫觀世音
- „Göttlicher Held,“ errettet Menschen. In Japan als Juntei vor allem im Shingon, oder, nur im Tendai, (Beschreibendes Ritualbuch, verf. im 15. Jh.: Roku kannon gōgyōki) als Fukūkenjaku mit ihrer charakteristischen Schlinge.
- 天人丈夫觀世音
- „Allmächtiger Brahma,“ (skt. Mahābrahmā, jap. daibonten) als Nyo’irin-Kannon, die Wesen aus den Himmeln errettet.
Die Senjū- des Kiyomizudera (Kyoto) und die Nyo’irin-Kannon des Ishiyama-dera (Shiga-ken) werden nur alle 33 Jahre öffentlich gezeigt, offiziell existieren von ersterer keine Photos. Unregelmäßig, aber ebenfalls selten gezeigt werden die Statuen im Kanjin-ji (Osaka), Jimokuji (Aichi) sowie Tempukuji (Chiba-Stadt). Solches sollte in alter Zeit zum Mysterium beitragen. Gerade bei den deshalb gut erhaltenen Statuen die zu Nationalschätzen erklärt werden ist damit regierungsseitlich die Auflage verbunden, daß sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was manchmal von den Tempelvorständen eher zähneknirschend umgesetzt wird. Zum Beispiel wird die Nyorai-Figur aus dem 10. Jahrhundert im Seiryō-ji nur einmal im Monat, jeweils am 8., gezeigt. Besucher an anderen Tagen können für 400 Yen eine Bildpostkarte kaufen.
Kunstgeschichte
In Japan finden sich sechs Manifestationen mit sieben Formen von Avolokiteśvara/Kannon, die Einflüsse des (tibetanischen) Mahayana zeigen: 1) Shō-Kannon (Weisheits-K.), 2) Juichimen (11köpfige-K.), 3) Senjū (1000armige-K.), 4) Juntei, 5) Fukū-Kenjaku, 6) Batō (Pferdekopf-K.), 7) Nyo’inrin. Die Darstellungen der ersten drei folgen Formen der tibetischen Göttin der Gnade. Bato’s Vorbild ist der tibetische Gott Hayagrīva. Vorbild für Juntei ist die Göttin Cundā (bzw. Cuntī). Im Tendai verwendet man Juntei nicht; Shingon verzichtet auf Fukū-Kenjaku.
Wann die ersten Skulpturen nach Japan gelangten kann nicht mehr festgestellt werden, jedenfalls gehören Kannon-Statuen zu den frühesten buddhistischen, plastischen Darstellungen, sie finden sich schon in der Hakuhō-Ära. Bereits die aus Shiraki an Suiko gesandte Figur könnte diesen Bodhisattva darzustellen. Spätestens Dōshō (道昭; 629–700), einer der Bringer der Hossō Schule, dürfte bei seinem Studien bei Hsüan-tsang in China sie kennengelernt haben. Bekanntermaßen brachte er mehrere Skulpturen mit, worunter wohl Avolokiteśvara sowohl in weiblicher als auch männlicher Form gewesen sein dürfte. Wirklich populär gemacht wurde dieser Bodhisattva aber erst im tantrischen (esoterischen) Shingon, dessen Gründer Kūkai sich vom Kami in Ise die „Genehmigung“ holte, diesen „fremden Gott“ in Japan anzusiedeln.
Japanische Darstellungen der Krone haben i. d. R. mehr (herabhängende) Ornamente, anstelle der in Tibet üblichen 5fältigen Kopfbedeckung. Brust und Schultern sind fast immer unbedeckt dargestellt, wenn auch eine Halskette und der traditionelle Schal von der linken Schulter über die Brust geworfen ist, der dann graziös über die Arme fällt. Das um die Hüften geschlungene Tuch reicht bis zu den Knöcheln und folgt dem Gandhāra-Stil. Die Ohrläppchen sind, indischer Tradition folgend, stets stark verlängert, die Augen aber im japanischen Stil dargestellt. Üblicherweise findet sich die ūrṇā sowie hinter der Krone („Mitra“) die ushṇīsha. Gelegentlich folgt das Muster der Bekleidung der eines (japanischen) Buddhas, bleibt von diesem jedoch durch die reiche Kopfverzierung unterscheidbar.
Nach den Anfängen als Kannon über Shōtoku Taishi und Kūkai popularisiert wurde, was sich auch an ihren Legenden im NR zeigt, geriet sie in der frühen Heian-Zeit etaws in den Hintergrund, um dann gegen der Ende Epoche und in der folgenden Kamakurazeit, also dem 12.-14. Jahrhundert in Form des „Kult der sechs Kannon“ zu neuer Blüte zu gelangen. Die älteste datierte Darstellung stammte von 1141. Hier hatte man sie auf den vier Seiten eines bronzenen Sutrenbehälters (Gefunden auf der Kunisaki-Halbinsel auf Kyushu. Heute größtenteils im Besitz des Chōan-ji, Ōita-ken, der Rest in mehreren Museen) eingraviert, der auch 37 Tafeln mit Texten des Lotussutras enthielt. Inzwischen hatten japanische Künstler auch die Herstellung von zusammengefügten Statuen aus ausgehöhlten Holzstücken vervollkommnet. Leider hat der Zahn der sehr kriegerischen Jahrehunderte nur wenige Originale dieser Zeit überleben lassen. Die von Jōkei ab 1224 für die Haupthalle Senbon Shakadō (千本釈迦堂) des Daihōon-ji (大報恩寺 im Kamigyō-ku von Kyoto. Während des Onin-Kriegs unbeschädigt. Daher heute das älteste Gebäude in der Stadt) geschaffenen Gruppe ist das wohl bedeutendste erhaltene Beispiel dieser Zeit. Die meisten anderen Gruppen sind aus (Replikas) der Edo-Ära.
In den esoterischen Schulen wird Kannon oft in auf Seide gemalten Mandalas dargestellt. Zen-Maler ab dem 13. Jahrhundert zeigen sie oft in weißer Robe (entspannt) in einer Grotte, einem Bambushain oder bei einem Wasserfall sitzend. Oft ist sie auch von tosenden Wellen, die sie beruhigt, umgeben.
Zur Zeit der Chistenverfolgungen in der Tokugawa-Zeit wurden „Marien-Kannon“ hergestellt, in denen ein Jesuskind versteckt war. Bereits in China hatten Jesuiten, denen bekanntlich jedes Mittel Recht ist Seelen zu gewinnen, zu dem Trick gegriffen Maria mit Guānyīn gleichzusetzen, da für Ostasiaten ein „Gott,“ der durch die für Sklaven reservierte Art der Hirnrichtung der Kreuzigung stirbt, schwer zu akzeptieren war.
Häufige Typen
1) Der Shō-Kannon (Arya) ist die einfachste Darstellung des Bodhisattvas, nämlich die seiner Manifestation Padmapāṇni (蓮華手菩薩). Der stehende Jüngling, mit halb-geschlossenen Augen, zeigt entweder das Vitarka oder Varada-Mudra. Sein Symbol ist der Lotus, meist als Knospe. Das Haar hinter der Krone ist in der Form der ushṇīsha. Vielfach ist ein Oberlippenbärtchen angedeutet, die Schultern sind meist frei. Das in indischen Darstellungen gelegentlich vorkommende Antilopenfell fehlt in Japan immer. Falls Juwelen dargestellt werden, entsprechen sie nicht den 13 traditionellen Ornamenten eines Bodhisattvas.
Eine schöne Bronzeskulptur des Padmapāṇni von ca.570 findet sich im Museum of Fine Arts, Boston.
2) Die Juichimen-Kannon (skr.: Ekādaśa-mahākarunika-Lokeśvara), ist in der Darstellung des Körpers (mit nur zwei, selten vier Armen) nicht unähnlich 1, der Kopfschmuck besteht jedoch aus elf Köpfen, die normalerweise in zwei Reihen zu drei und einer zu fünf angeordnet sind. Der Kopf Amithābha’s entspringt der ushṇīsha. Gelegentlich ist einer der mittleren Köpfe durch eine buddhagleiche Figur ersetzt. Diese repräsentiert Kikuta Sanzō, (? syn. Nāgabodhi von Nalānda. Ältere Mss. finden sich in der Shōmyōji-Sammlung des Kanazawa Bunko (金澤文庫). Einige eher heterodoxe Lehren scheinen unter seinem Namen erhalten zu sein. Beim Mantra Kikura ichin z. B. hält der Übende seinen Penis (euphemistisch onzō) in einem Mudra steif.) einen indischen Prinzen, der im 7./8. Jhdt. für die Ritsu-Schule in Japan wirkte, aber heute eher mit Shingon in Verbindung gebracht wird. Erkennbar ist der Bodhisattva an seinen immer bedeckten Händen.
Die linke Hand des Bodhisattva hält eine Vase, in der sich meist eine Lotusblüte befindet. Die rechte Hand – im „Wohltätigkeits“-Mudra – hält entweder einen Rosenkranz oder shakujo. (錫杖; skr.: Khakkhara.)
 Sofern die Darstellung einen Heiligenschein mit enthält, finden sich in diesem auf jeder Seite fünf Sonnen und ein cintāmaṇi. Die elf Köpfe, zehn davon meist kleiner, der Juichimen Kannon symbolisieren die Eigenschaft in alle Richtungen zu sehen („allsehend zu sein.“) Für hölzernen Statuen wurden sie separat gefertigt und dann verzapft. Die 11köpfige Kannon des Yakushiji ist eine der berühmtesten. Eine der schönsten erhaltenen ist die Rōben zugeschriebene, aber wohl erst nach 750 entstandene Statue im Sangatsu-dō des Tōdai-ji, die nur selten öffentlich gezeigt wird.
Sofern die Darstellung einen Heiligenschein mit enthält, finden sich in diesem auf jeder Seite fünf Sonnen und ein cintāmaṇi. Die elf Köpfe, zehn davon meist kleiner, der Juichimen Kannon symbolisieren die Eigenschaft in alle Richtungen zu sehen („allsehend zu sein.“) Für hölzernen Statuen wurden sie separat gefertigt und dann verzapft. Die 11köpfige Kannon des Yakushiji ist eine der berühmtesten. Eine der schönsten erhaltenen ist die Rōben zugeschriebene, aber wohl erst nach 750 entstandene Statue im Sangatsu-dō des Tōdai-ji, die nur selten öffentlich gezeigt wird.
Die Juichimen-Kannon aus der mittleren Heian-Zeit in der Kannon-dō des Dōgan-ji (渡岸寺観音堂; Takatsuki, Shiga) ist als besonders gelungenes Exemplar ein japanischer Nationalschatz.
Eine verbreitete Variante der Juichimen-Kannon ist der Hasedera-Stil. Im namensgebenden Tempel in Sakurai (Offiziell erwähnt im Shoku Nihongi 768, aber auch Fusō ryakki und Teiō hennenki für 720/30. Anschrift 〒633-0112 奈良県桜井市初瀬731-1. Ebenfalls dem Tempel gehört der Nationalschatz Dōban Hokke sessō-zu ein 83,3 ⨉ 74,0 cm großes Relief aus Bronze von 686, das die Geschichte der Erscheinung des tahō nyorai gemäß dem Juwelenstupa-Kapitel [kempō tōbon] des Lotussutras abbildet. Heute als Leihgabe im Nationalmuseum Nara) (長谷寺) befindet sich eine 9,30 Meter hohe Statue, die, glaubt man den Gründungsgeschichten (Die erst aus der späten Heianzeit stammenden Hasedera engimon [長谷寺縁起文 in GR (1901), Vol. 15], Hasedera reigenki [長谷寺霊験記 in ZokuGR (1935), Vol. 27, 2] sowie die in mehreren Abschriften erhaltenen Bildrollen des Hasedera engi emaki. (Besonders prachtvoll ist die Kopie von 1523.) Im SB (verf. 984, Kap. Hase bosatsu kai) findet sich auch die Legende, daß eine Flut 601 einen großen Baum aus wohlriechendem Holz angeschwemmt habe) auf Anregung des Shōmu-tennō vom Mönch Tokudō 733 geweiht worden sein soll. Allerdings wurde jene Figur, die 7,80 Meter groß auf einem 2,40 Meter hohe Sockel stand, ebenso wie sechs ihrer Nachfolger bei verschiedenen Bränden zerstört. Das heutige Bildnis stammt aus dem Jahre 1583. Stilistisch charakteristisch ist, daß diese Art 11köpfige Kannonen einen Mönchsstab (shakujō) in der rechten Hand hält, was eine Addition der späten Heian-Zeit ist und sich in keiner älteren ikonographischen Beschreibung findet. Die Figur wurde im Mittelalter oft im Kleinen kopiert, wohl auch deshalb um so die immer wieder nötig gewordenen Neubauten finanzieren zu können. Prägend für die Änderungen war der aus dem Fujiwara-Klan stammende (Der Hasedera geriet 1131 in den Bannkreis des zweitmächtigsten Tempels Yamatos, dem Kofukuji und war ab 1136 auch noch mit dem Kasuga-jinsha verbunden. Beides bekanntermaßen von Alters her Institutionen die von den Fujiwara getragen wurden. Vielleicht entstanden gerade deshalb in jenen Jahren die Tempelgeschichten) Mönch Gyōnin († ? 1120), der nach dem Brand 1094 den Wiederaufbau und die Schaffung der vierten Statue organisierte, die 1131 fertig wurde. Erwähnung findet der Stab erstmals in der Ikonographiesammlung Zuroku shō, abgefaßt 1139/40 sowie im bald darauf von Shinkaku zusammengestellten Besson zakki (仏教図像, 57 Fasz.). Die älteste bekannte Figur des neuen Typs findet sich Inneren einer Jizō-Statue (地蔵菩薩立像. Beschrieben wird die kleine Figur auf der Webseite des Tempels: 十一面観世音菩薩立像: 地蔵菩薩立像の胎内仏、頭上面より台座までを、白壇の一材から彫成している。小品ながら丁寧な作技ををみせ、時代の特色もうかがわれる。納入の経緯・趣意も明確で、胎内納入仏の諸例中、最も注目すべき作品であるとされる。) aus dem Jahre 1228, die ursprünglich im Besitz des Kofukuji war und heute dem Denkō-ji (伝香寺, Anschrift: 〒630-8233 奈良県奈良市小川町24) gehört. Ob man durch die Hizufügung des Stabes, der ein Merkmal des damals ebenfalls sehr beliebten Jizō ist, Anleihen an dessen Popularität machen wollte wird sich wohl nicht klären lassen.
3) Senjū (千手千眼; 千手千眼大慈大悲觀音菩薩 Sahasrabhuja-arya-avalokiteśvara, kurz: Sahasrabhuja-sahasranetra), die 1000armige-Kannon5 wird nur in den seltensten Fällen tatsächlich mit eintausend Armen dargestellt. Üblicherweise beschränkt man sich auf 42 Arme. Nur zwei der Paare sind nicht ausgestreckt, sondern vor der Brust der Figur, die oberen Hände halten dann eine pātra (應器, Almosenschale) oder zeigen das Gebets-Mudra. Im zweiten Armpaar findet sich eine Schale mit Nektar, oder sie zeigen hinter dem Kopf auf Höhe der Krone das Añjali-Mudra, selten ein Vajra oder eine kleine Amitābha-Figur haltend. Die restlichen Hände können (tantrische) Symbole halten. Jeder der 40 Arme reicht durch die 25 Ebenen der Existenz (25 ⨉ 40 = 1000 + 2 gewöhnliche).6
Als Begleiter dienen der 1000händigen Kannon die 28 Gruppen Genien. (二十八部衆; skr.: ṛṣis) Sie stehen unter dem Kommando von Mayūrarāja. (孔雀王 Kujaku Myōō. Auf einem Pfau sitzend mit vier Armen dargestellt)
Zu Nationalschätzen erklärt sind in Kyoto die Senjū-Kannon des Kōryū-ji (266 cm, vor 873), Hosshō-ji (109,7 cm, um 934) und in der Sanjūsangen-dō des Myōhō-in eine sitzende Darstellung von Tankei (1251–4, 334,8 cm) mit 28 Begleitern. Die Statue der Hon-dō des Fujii-dera (葛井寺) von Osaka hat 1041 Arme, nämlich 2 „normale,“ 38 große und 1001 kleine dem Rücken der Statue entspringend. 131,3 cm, Mitte des 8. Jhdt.) Im zum selben Komplex gehörenden Dōmyō-ji befindet sich auch eine stehende 11köpfige Statue aus der frühen Heian-Zeit (99,4 cm).




Vier der 28 Begleiter-Statuen der 1000armigen Kannon im Myōhō-in (妙法院) in Kyoto-Higashiyama. In dessen Sanjūsangen-dō (三十三間堂) stehen 1000 weitere Kannon-Figuren, von denen 124 noch Originale aus der Bauzeit 1164 sind, die restlichen fertigte man beim Wiederaufbau im 13. Jhdt. neu.
4) Die immer weiblich, meist sitzend dargestellte Juntei (準提觀音) leitet sich von der indischen Göttin Cuntī ab (skr.: vollständig Sapta-kotī-Buddha-mātṛ-Cuntī-devī 七倶胝佛母尊, syn. Marīci 摩利支), bzw. Cuṇḍī, die nachdem sie die drei Meditationen (三重法界. Der Beziehungen zwischen nomenal und Phenomenalem. In der Kegon a) daß das Universum und das Gesetz [Dhamma] eins (眞如), d. h. von derselben Buddha-Natur sind; b) 理事無礙法界, daß die Buddha-Natur und das Dingliche (also das Absolute und Phenomäne) sich gegenseitig ausschließen; c) 事事無礙法界, daß Phänomene untereinander sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern einen Teil eines harmonischen Ganzen bilden) vollendet hatte, vom Buddha geleitet wurde. Im indischen Pantheon entspricht sie Durgā-devi, der Frau Shivas. Ihre Legende ähnelt eher der deas menschenfressenden Ungeheuers Hāritī. Cuntī soll die 70.000 – nach japanischer Vorstellung 100.000 – Buddhas geboren haben. Meist wird sie friedlich, gelegentlich aber auch als tobende Göttin dargestellt. Sie hat in ihren achtzehn Armen verschiedene Symbole und trägt das dritte Auge auf der Stirn. Die beiden „normalen“ Arme zeigen das renge no in-Mudra, wobei jedoch nur der Ring- und der kleine Finger eingehakt sind. Die Hände des obersten Armpaars halten Schwert und Banner. Gekleidet ist sie in wallende Gewänder, meist weiß. Den ushṇīsha bedeckt eine konische Kopfbedeckung („Turban“).
5) Fukū-Kenjaku (不空羂索観音; skr.: Amoghapāśa), die „Kannon mit der Fangschlinge,“ oft sech-, seltener achtarmig dargestellte Manifestation Kannons, die der Tendai-Schule zufolge in der Menschenwelt wandelt, um dort die Wesen zur Erlösung zu führen. Mit ihr verbunden ist u.a. das Amoghapāśa-kalparāja (不空羂索神変真言経. „Sutra über das Mantra der unfehlbaren Fangschlinge und die übermenschliche Transformation“ – in dem auch erstmals Fudō-Myōō erwähnt wird – T. 1092, Übs. Bodhiruci im Sommer des 3. Jahres Shen Lung (神龍; 707), T’ang-Dynastie, im Xīchóngfú-Kloster (西崇福寺, W.-G.: Hsi-ch’ung-fu Ssu). In Japan später eingeführt als die anderen Manifestationen. Stehend oder sitzend dargestellt, zeigen die normalen Arme das Gebets-Mudra, in den obersten werden shakujo und Lotusblüte gehalten. Ein weiteres Händepaar formt das Wohltätigkeits-Mudra (vara). Selten mit Juichimen-Krone, fehlt meist ein solches Zierat ebenso wie die ūrṇā fehlen kann.
6) Batō, die seltener zu findende „Pferdekopf-Kannon,“ repräsentiert den tibetischen männlichen Gott Hayagrīva, (馬頭觀音; 馬頭大士; 馬頭明王; 賀野紇哩嚩; 賀演屹哩嚩; auch eine Erscheinungsform Vishnu’s. Gelegentlich mit Pfeil und Bogen.) gilt aber im Volksglauben als Repräsentation der „Göttin der Gnade.“ Er hat entweder eines oder drei (dann unterschiedliche) Gesichter, darüber einen Pferdekopf. Der Pferdekopf soll die Ungläubigen durch Erschrecken bekehren. In ihren acht Händen halten sie üblicherweise buddhistische Symbole oder Waffen. Fünf der Symbole entsprechen denen des Hayagrīva, eine Hand zeigt das Vara-Mudra. Die beiden gewöhnlichen Arme formen das renge no in-Mudra, die Lotusblüte repräsentierend, wobei alle Finger eingehakt sind und die Zeigefinger sich an den Spitzen berühren. Die Haartracht ist abstehend. Der Bodhisattva wird sitzend oder „königlich entspannt“ mit dem rechten Knie hochgezogen dargestellt. Der Gesichtausdruck ist immer grimmig, mit dem dritten Auge. (Gewissse Ähnlichkeit zu Darstellungen des Myōō.)
Das Pferd, besonders der Schimmel, hat im Buddhimus umfassende symbolische Bedeutung. Nicht nur war das Pferd auf dem Shakyamuni in die Hauslosigkeit zog (Kaṇṭhaka) weiß, auch wurde laut dem Mahāyāna-Sutra Siṃhala (also der Buddha) von einem Pferd vor den Nachstellungen der kannibalistischen Dämonen, den Rākshasa gerettet. In der chinesischen Tradition spielt das weiße Pferd eine Rolle in der Vision (63 u.Z.) vom „vollkommenen Menschen“ des Kaisers Hàn Míngdì (Vgl.: 法苑珠林 (T. 2122), Kap. VI, 2 häufig zitiert jeweils in Details anders; dazu Referenzen in den Kap. XVIII, XX (Matanga im Kloster vom weißen Pferds, Chang-an), LV (Belehrung des Kaisers, zahlreiche Ordinationen u. Klostergründungen). Letzteres auch in Sangoku denki, IX, wo der Traum phantastischer geschildert wird. Auch in der im 13. Jh. kompilierten Geschichte der Tendai, T. 2035, Kap. 35, T. 2084, Fasz. 1.) (r. 57-75 u.Z.), die zum Besuch der ersten beiden buddhistischen Mönche aus Tochara führte.
Man kann die Erretung (durch Kannon) in Form eines weißen Pferdes, die sich in Verebindung mit dem Fumon-bon in Japan erst ab dem 11. Jhdt. findet, aber auch vom Valahassa-Jātaka (№ 196) hergeleitet interpretieren. In der japanisierten Legende werden, je nach Variante, acht auf einer Dämoneninsel gestrandete Kauf- oder untergehende Seeleute durch das Pferd aus ihrer Not befreit.
7) Die „allmächtige“ Nyo’inrin-Kannon (如意輪觀音) dient im japanischen Glauben seit der Heian-Zeit7 der Wunscherfüllung. Zu Darstellungen der gehört das in einer Hand gehaltene Juwel (Perle), es symbolisiert die Erhörung jeden Gebets. Nyo’inrin bedeutet etwa „Wunschrad.“ (skr.: Cintāmaṇcakra) Auch sie hat oft zahlreiche Arme, die außer dem Rad des Gesetzes noch Lotusblüten, Juwelen u. ä. halten. Charakteristisch ist, daß die Augen halb geschlossen sind, die rechte Hand sich auf die Wange stützt und dabei eine Meditationsstellung einnimmt, die als hanka shiyui bezeichnet wird (Halblotossitz, wobei ein Bein wie beim Lotossitz angezogen ist, das zweite aber locker vom Sitz herabhängt). Auch mit ihr sind mehrere Sutren (z. B. T. 1082, 1087) verbunden. Die Legende, der Shōmu-tennō habe zu ihr um Gold gebetet und dieser Wunsch sei indirekt mit den Funden in Mutsu erfüllt worden ist eine hagiographische Zuschreibung späterer Jahrhunderte, die sich erstmals im Sambo Ekotoba findet.
Eine der ältesten Statuen stammt aus dem Chūguji (dort steht heute eine Replika), ursprünglich Residenz der Kaisergemahlin Anahobe no Hashibito, Frau Yōmei’s (? 519–87; r. 586), erhalten. Eine berühmte Statue befindet sich in der Kondō des Tōdaiji. Die in der Kondō des Kanshin-ji von Osaka befindliche Statue (108,8 cm; um 840) ist Teil einer San Nyo’inrin genannten Gruppe, die japanischer Nationalschatz ist. Ein weiterer Nationalschatz ist die in der Haupthalle des Gantoku-ji (願徳寺) in Kyoto aufgestellte Figur, die während des nengo Jōgan (859–77) entstand.